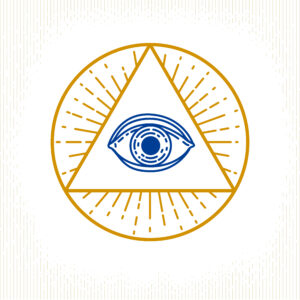Jesus kommt nicht heil zurück. Auferstehung bedeutet nicht, dass alles wieder gut ist. Es bedeutet nicht, dass die Geschichte aufgehoben wird wie ein Missverständnis. Sie bleibt – lesbar im Leib Christi. Die Wunden sind nicht verheilt, nicht geglättet, nicht übermalt.
„Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ (Joh 20,27). So spricht er zu Thomas – das ist kein Tadel, sondern eine Einladung, eine zum Glauben. Wer dem Auferstandenen begegnet, sieht keinen Unversehrten. Er sieht den Gekreuzigten. Die Nägel haben geprägt. Was sie hinterlassen haben, bleibt offen. Jesus versteckt die Spuren nicht. Ganz im Gegenteil. Er trägt sie, wie man etwas trägt, das einem gehört.
Auferstehung verwandelt. Und sie zeigt, was war. „Durch seine Wunden seid ihr geheilt“ (1 Petr 2,24). Eine Erlösung ohne Wunde ist weder möglich noch nötig.

Der verwundete Gott
Gott zeigt sich nicht im Unverletzbaren. Er zeigt sich im Durchbohrten. Er zeigt sich dort, wo Menschen glauben, dass nichts mehr möglich ist. Die Jünger hatten abgeschlossen. Sie hatten weggesperrt, was geschehen war – mit Riegeln, mit Angst, mit Flucht. Und plötzlich steht er da. Mitten unter ihnen.
„Friede sei mit euch!“, sagt er (Joh 20,19f). Und dann zeigt er seine Hände und seine Seite. Als Zeichen, dass er es ist – wirklich er. Der, der gelitten hat. Der, der gestorben ist. Der, der durch den Tod hindurchgegangen ist und jetzt dasteht, ohne sich zu verstellen.
Die Wunde ist keine Schwäche. Sie ist Offenbarung. Sie ist das Gegenteil von Täuschung. Ein Gott ohne Wunden wäre unberührbar. Der Christus, ja Gott selbst, ist berührbar – weil er berührt wurde.

Was bleibt, ist die Öffnung
Die Wunde ist nicht das Ende. Aber sie bleibt. Sie bleibt als Raum. Als Einlass, durch den man hindurchmuss, wenn man ihm folgen will. Glauben beginnt nicht im Triumph. Er beginnt in der Verletzbarkeit. Die Jünger erzählen von Begegnung – mit einem, der ihnen alles zeigt, was man ihm angetan hat. Und sie sehen: Er lebt.
Thomas glaubt nicht, weil man es ihm sagt. Er glaubt, weil er die Wunde sieht. Weil er sie berühren darf. „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28). Das ist das erste klare Bekenntnis nach Ostern. Es kommt aus der Konfrontation mit der offenen Seite.
Glauben heißt nicht, dass der Schmerz verschwindet. Es heißt, dass er nicht mehr zerstört. Die Auferstehung nimmt die Last nicht weg. Sie gibt ihr dafür eine klare Richtung. Sie macht aus der Wunde ein Tor.

Kirche aus der Wunde
Die Kirche lebt aus der Wunde. Nicht aus Macht, nicht aus Perfektion. Wer in ihr nur das Reine sucht, hat Christus nicht gesehen. Die Wahrheit der Kirche liegt nicht in ihren Erfolgen. Sie liegt in dem, was geblieben ist – trotz Versagen, trotz Schuld, trotz Flucht.
Petrus war der Erste, der weinte (vgl. Lk 22,62). Maria war die Erste, die losließ (vgl. Joh 20,17). Thomas war der Erste, der zweifelte (vgl. Joh 20,25). Sie alle tragen ihre Spuren. Und sie alle gehören zu denen, die ihn gesehen haben.
Die Wunde ist nicht peinlich. Sie ist nicht zu verstecken. Sie ist das Zeichen der Treue. Wer glaubt, tut es mit offener Seite.