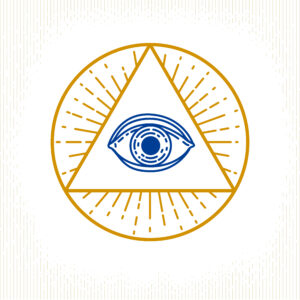Heute feiert die Kirche den heiligen Papst Leo I, „den Großen“. Der Namensgeber unseres heutigen Papstes Leo XVI trägt nicht umsonst den Beinamen „der Große“. Das fünfte Jahrhundert, in dem Leo wirkte, war eine Zeit großer Umbrüche: Instabilität des Weströmischen Reiches durch politische Machtkämpfe und Völkerwanderungen. Die Bedrohung Roms durch die Hunnen prägte die Stadt, während die Kirche durch theologische Streitigkeiten besonders um die Monophysiten und Pelagianer mit sich selbst beschäftigt war. In dieser Lage wird Leo der Große im Jahr 440 Bischof von Rom. Er trat als klarer Lehrer, entschlossener Hirte und fester Verteidiger der kirchlichen Einheit auf. Sein Wirken verbindet auf einzigartige Weise die Deutung des Geheimnisses der Menschwerdung Christi mit der Leitung der Kirche und der Gestaltung der Liturgie. Ein roter Faden, der sowohl seine Pastoral prägt als auch seine Sicht auf das Amt des Bischofs von Rom.
Die Menschwerdung Gottes – Christus als Mitte
Bald feiern wir die Geburt unseres Herrn. Für Leo war die Geburt Christi kein bloßes Fest der Erinnerung. Das Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist der Kern des Glaubens selbst. Er schreibt in einer seiner vielen Weihnachtspredigten: „Und die Kirche, die der Leib Christi ist, freue sich über die Geheimnisse ihrer Erlösung! Denn würde nicht das Wort Gottes Fleisch annehmen und unter uns wohnen; stiege nicht der Schöpfer selbst herab, um sich mit seinem Geschöpfe zu vereinigen; riefe er nicht durch seine Geburt das alte Menschengeschlecht zu neuem Leben zurück, dann herrschte der Tod von Adam bis zum Ende, und alle Menschen träfe unabwendbare, ewige Verdammnis, da für alle die bloße Tatsache ihrer Geburt der gleiche Grund des Verderbens wäre.“ (Sermo XXV, 5)
Christus erschließt den Weg zur Überwindung menschlicher Verletzlichkeit. Indem Gott selbst menschliche Natur annimmt, wird der Weg zur Erlösung geöffnet. Für Leo sind die göttliche und die menschliche Natur in der einen Person Christi untrennbar verbunden. Dies vermittelt er nicht nur theologisch, sondern besonders pastoral. Wer dieses Geheimnis erkennt, versteht die Verantwortung des Glaubens, die Möglichkeit der Mitwirkung am Heilsplan und die Nähe Gottes.
Im Jahr 449 schrieb Leo den berühmten „Tomus ad Flavianum“ an den Patriarchen von Konstantinopel, eine theologische Abhandlung, die später auf dem Konzil von Chalkedon (451) Grundlage der Beschlüsse wurde. Darin legt der heilige Leo dar, dass Christus „in zwei Naturen, unvermischt und ungeteilt“ existiert – göttlich und menschlich. Diese Lehre war praxisrelevant, weil sie erklärte, wie das Leben der Gläubigen, die Feier der Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums zusammenhängen.
Die Menschwerdung ist keine poetische Metapher. Gott entscheidet sich, an der menschlichen Existenz teilzunehmen. Daraus leitet Leo ab, was der Glaube bedeutet. Er richtet den Menschen auf, da Christus nicht fern ist. Diese Überzeugung prägt seine Art, theologische Streitfragen ernst zu nehmen. Es geht um die Wahrheit, die den Menschen trägt. Die Wahrung der Wahrheit über Christus und seine Menschwerdung stiftet die Einheit der Kirche. Dieser Gedankenbogen bleibt bei Leo dem Großen konsequent.
Die Einheit der Kirche aus der Kraft der Menschwerdung
Aus Leos Sicht steht die Kirche nicht in sich selbst, sie gründet im Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Die Wahrheit über den, der Mensch und Gott ist, prägt jede Form kirchlicher Leitung. Deshalb betont Leo der Große, dass die Inkarnation nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit ist: „Die Worte des Evangeliums und der Propheten … entflammen unseren Geist und lehren uns, die Geburt des Herrn, das Geheimnis des Wortes, das Fleisch geworden ist, keineswegs als reine Erinnerung an ein vergangenes Ereignis zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um eine Wirklichkeit, die sich vor unseren Augen ereignet … Es ist, als würde uns am heutigen Hochfest neu verkündet: ›Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr‹.“ (Sermo XXIX, 1) Damit zeigt Leo: Die Einheit der Kirche entsteht nicht durch organisatorische Fertigkeit oder politischen Einfluss, sie wächst aus der realen Verbundenheit mit Christus.
„Hat er sich doch in der Weise mit uns und uns mit sich vereint, daß durch das Herabsteigen der Gottheit zu uns Menschen der Mensch zu Göttlichem erhoben wurde.“ (Sermo XXVII, 2) Die Gefahr der damaligen Zeit lag in einer Verfälschung des Wissens über Gott und Mensch. Leos „Tomus ad Flavianum“ ist Ausdruck der Verantwortung seines Amtes. Die Klarheit, mit der er die beiden Naturen Christi beschreibt, soll Gläubige schützen, damit sie Christus begegnen können, der wirklich Mensch ist und wirklich Gott.
Dass Leo mit dieser Haltung politisches Gewicht gewann, zeigt das Jahr 452. Als die Hunnen Rom bedrohten, reisten Delegationen mit Leo dem Großen zu Attila. Zeitgenössische Quellen berichten, dass Attila nach der Begegnung mit ihm seinen Zug abbrach. Auch wenn sicherlich politische Faktoren eine Rolle spielten, zeigt die Episode Leos Grundhaltung: Er übernimmt Verantwortung, unabhängig von der Gefährdung. Berichte der Zeit betonen seine Ruhe. Seine Autorität gründet in der geistigen Klarheit seiner Christologie. Wer Christus als den wahren Mittler versteht, kann auch Mittler zwischen Völkern sein. So formt der heilige Leo der Große ein Leitungsverständnis, das theologische Wahrheit und praktische Verantwortung verbindet. Die Kirche ist für ihn der Leib Christi, der nur lebendig bleibt, wenn er aus der Quelle der Inkarnation schöpft. Die Einheit der Kirche ist kein verwaltetes Ziel, sie ist Gabe, die gepflegt wird. Dadurch erhält die Auseinandersetzung mit Häresien einen tieferen Sinn.
Orientierung aus dem Geheimnis Christi
Der heilige Leo I bleibt ein Lehrer für Zeiten der Unsicherheit. Er zeigt, dass Glauben aus der Begegnung mit dem menschgewordenen Gott entsteht. Die Menschwerdung Christi ist für ihn die Mitte jeder Predigt, jeder Entscheidung und jeder Form pastoraler Sorge. Seine Botschaft bleibt bis heute wirksam. Auch für unsere Zeit. Denn wo Menschen Halt suchen, weist Leo auf Christus. Wo die Kirche mit Herausforderungen ringt, erinnert er an die Einheit, die aus der Menschwerdung Gottes kommt. Wo die Welt verletzlich erscheint, zeigt er, dass Gottes Weg in die menschliche Geschichte führt und den Menschen befähigt, im Glauben zu stehen und ihm nahe zu sein.
Hoffen wir, dass unser Papst Leo XIV aus der Nähe zu Christus jene Orientierung empfängt, die schon Leo der Große aus der Menschwerdung des Herrn hergeleitet hat.