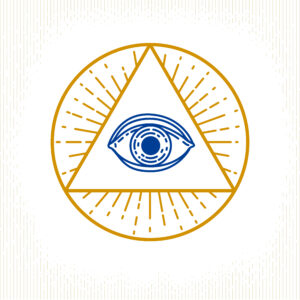Es klingt wie ein Gegensatz: Glaube richtet sich auf das Unsichtbare, Wissenschaft befasst sich mit dem Messbaren. Der eine vertraut, wo er nicht sieht – die andere beweist, was sich zeigen lässt. Und doch sucht der Mensch beides. Denn jeder will verstehen, woher er kommt und wohin er geht. Man fragt nach dem Ursprung der Welt und nach dem Sinn des eigenen Lebens. Darum stehen Glaube und Wissenschaft nicht als Gegner nebeneinander. Sie gehören zu den Grundbewegungen eines menschlichen Herzens, das nach Sinn und Wahrheit verlangt.
Glauben mit Verstand – Denken mit Offenheit
Viele Theologen waren auch Forscher. Albertus Magnus war Botaniker, Thomas von Aquin ein scharfer Naturbeobachter, Roger Bacon experimentierte mit Licht und Mechanik, Nikolaus von Kues entwarf kosmologische Modelle. Sie suchten Erkenntnis aus dem Glauben heraus und nicht gegen ihn. Ihr Glaube, dass die Welt geschaffen ist, untermauerte ihre geistige Haltung, dass sie auch untersucht werden kann.
Doch die Vernunft bleibt begrenzt. Wo sie sich vom Menschen abkoppelt und nur rechnet, verliert sie das Ganze aus den Augen. Technik zum Beispiel lässt sich einsetzen, ohne Rücksicht auf Schuld oder Leid. Das Denken ist zwar sehr präzise, aber oft kalt. Die Frage nach Gut und Böse fällt weg, wenn nur das Machbare zählt. Deshalb genügt die Vernunft nicht. Sie braucht ein Gegenüber, das erinnert: Die Welt und der Mensch sind nicht Objekt. Diese Perspektive lässt sich nicht aus Daten ableiten, aber sie entscheidet über Verantwortung.
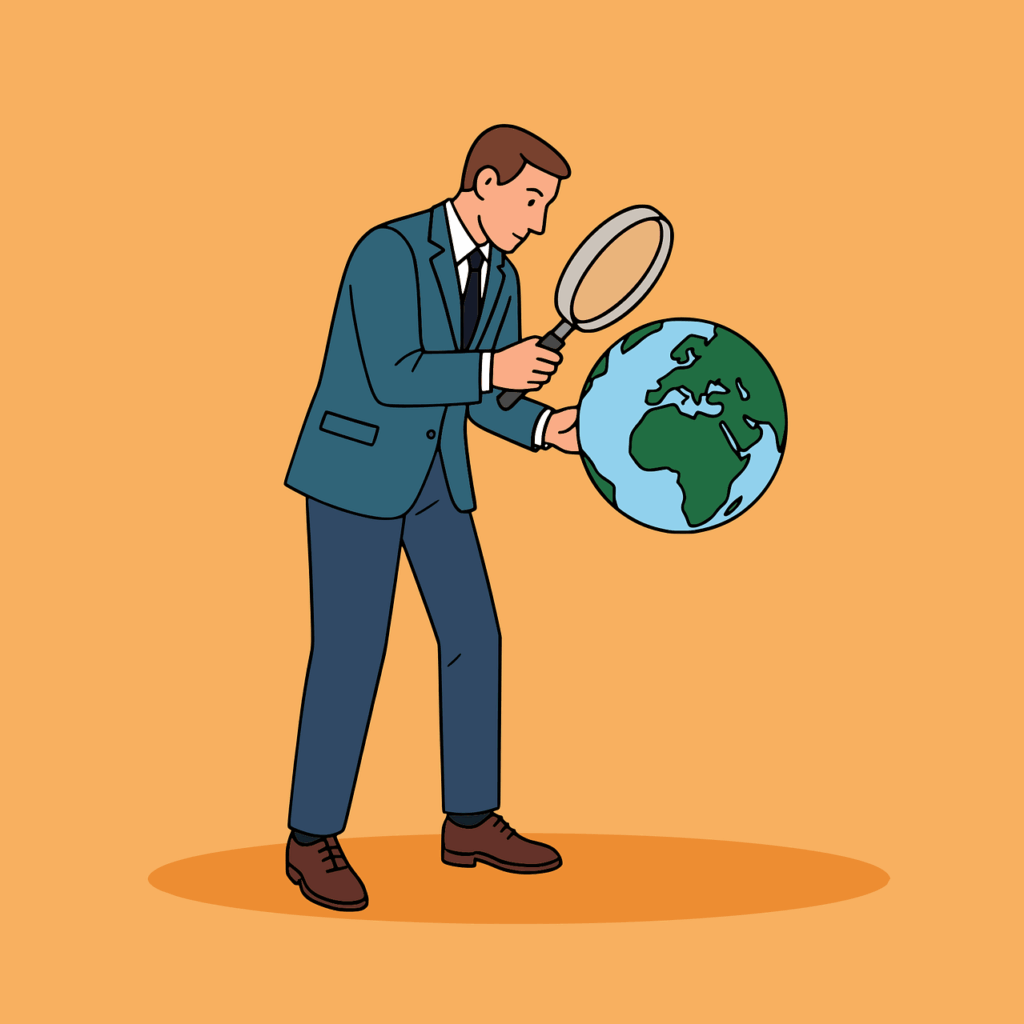
Glaube darf nicht gegen Vernunft stehen
Aber auch der Glaube verliert seinen Charakter, wenn er sich von der Vernunft abkoppelt. Wer nicht fragt, was wahr ist, öffnet dem Irrtum Tür und Tor. Aberglaube ist kein Kind des Vertrauens. Er ist das Ergebnis geistiger Nachlässigkeit. Wo Glauben mit Gewalt durchgesetzt wird, verfehlt er sich selbst. Die Geschichte kennt hier zu viele Beispiele: Kreuzzüge, Zwangsbekehrungen, religiös begründete Morde. Ein Glaube, der der Vernunft widerspricht und sie nicht ernst nimmt, wird gefährlich.
Darum braucht Glaube die Prüfung durch die Vernunft. Nicht als Kontrolle von außen. Sie ist ihr inneres Kriterium. Wer glaubt, muss wissen, was er da bejaht. Wer betet, muss auch bereit sein, zu denken. Der christliche Glaube selbst spricht von einem Ursprung, der mehr ist als eine Idee – von einem Gott, der sich offenbart hat. Deshalb muss alles, was im Namen des Glaubens gesagt oder getan wird, sich fragen lassen, ob es dem überhaupt entspricht. „Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.“ (Joh 16,13). Wahrheit hat keinen doppelten Boden. Sie hält Widerspruch auf Dauer nicht aus.
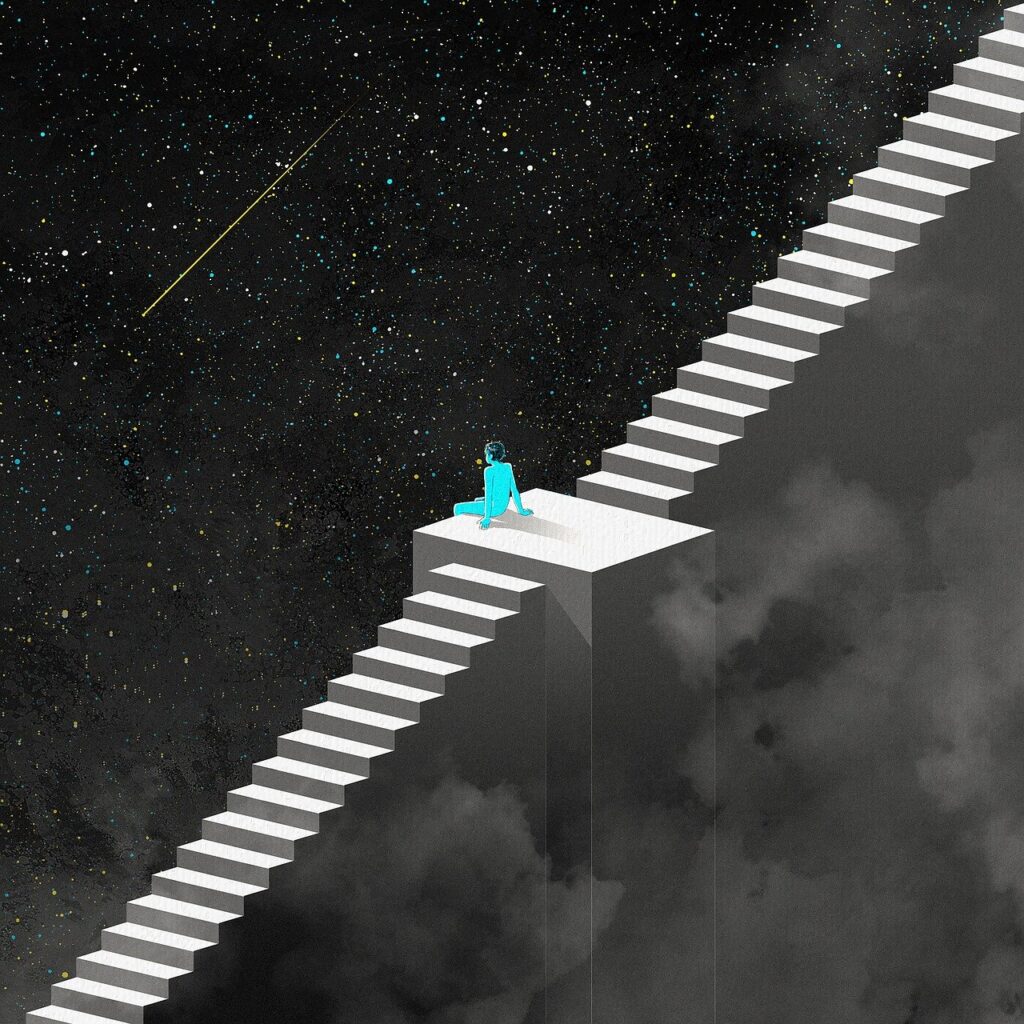
Wahrheit ist nicht teilbar
Glaube fragt nach dem Woher. Wissenschaft untersucht das Wie. Beide Wege gehören zusammen, weil Wahrheit eine Einheit bildet. Wo Glaube ohne Vernunft bleibt, wird er blind. Wo Vernunft ohne Glauben denkt, wird sie leer. Deshalb braucht es beides – in einer produktiven Spannung, aber nicht im bekämpfenden Widerspruch. Denn Gott ist der Herr der sichtbaren und der unsichtbaren Welt (Kol 1,16). Wer das erkennt, kann denken, glauben und leben – aus einem Guss.