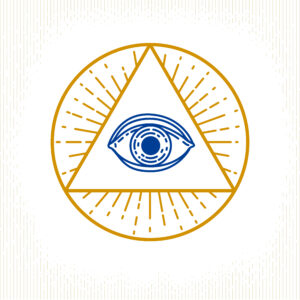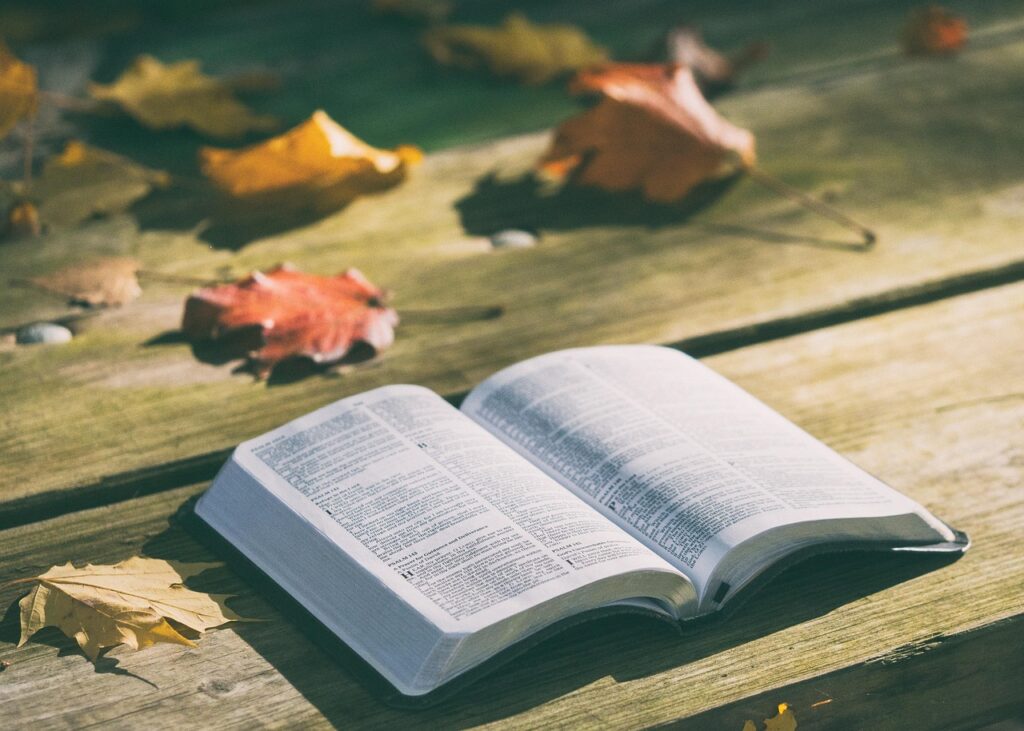
Der November führt die Kirche in eine Zeit, in der das religiöse Leben etwas stiller wird. Die Tage verlieren an Helligkeit, die Natur zieht sich zurück und die Liturgie richtet den Blick auf die Vergänglichkeit des Menschen. Wir beten für die Verstorbenen und halten zugleich die Hoffnung fest, die Christus uns eröffnet hat. Wenn wir in dieser Stille beten, wird auch die Endlichkeit unseres Lebens spürbar. Oft merkt man dabei, dass man Gott nicht ganz verstehen kann und dass Er größer ist, als wir denken oder ausdrücken können.
Die sogenannte apophatische Tradition der Kirche nimmt genau diese Erfahrung auf. Sie zeigt, dass es möglich ist, Gott zu begegnen, ohne Ihn durch Begriffe oder Bilder einzuschränken. Die Stille, das Innehalten und die Konzentration auf das Wesentliche ermöglichen den Glaubenden die Erfahrung, dass Gottes Wirken größer ist als alle Vorstellungen. Von diesem Grundgedanken aus öffnet sich ein Weg, der den Glauben vertieft.

Die apophatische Sicht
Die apophatische Tradition beginnt mit der Einsicht, dass der Mensch über Gott sprechen kann, weil Gott sich selbst offenbart hat. Durch die Offenbarung gibt Gott gibt dem Glaubenden die Gewissheit, dass Er eine Begegnung eröffnet und sich zu erkennen gibt. Pseudo-Dionysius Areopagita beschreibt, wie der Mensch auf die Offenbarung reagieren soll: „Und lasse dich in der Weise der Unwissenheit aufziehen, soweit es möglich ist, zur Vereinigung mit dem, der alle Wirklichkeit und Erkenntnis übersteigt“ (Über mystische Theologie I.1). Er weist damit darauf hin, dass der Mensch in der Begegnung mit Gott die eigenen Vorstellungen loslassen muss. Das bedeutet nicht, dass das Denken aufgegeben wird, sondern in eine Haltung gebracht wird, die Gottes Unermesslichkeit respektiert und sich auf das Wesentliche konzentriert.
Thomas von Aquin greift den Gedanken auf: „Denn sowohl wird die natürliche Kraft unserer Vernunft, vermittelst deren sie geistig leuchtet, durch das Einfließen des Gnadenlichtes der Offenbarung gestärkt; — als auch werden bisweilen mit göttlichem Beistande Phantasiebilder in der Einbildungskraft geformt, welche das Göttliche unter sinnlichen Bildern besser darstellen wie dies von seiten jener Phantasiebilder geschieht, welche die bloße Natur formt“ (Summa Theologiae I q.12 a.12).
Der Mensch denkt, sucht und betet, doch das Denken allein erfasst Gott nicht. Es ist Gott selbst, der durch sein Licht auf den Menschen zukommt, die Vernunft stärkt und die Phantasie unterstützt, sodass der Mensch Seine Wirklichkeit unter Bildern, die über die bloße Natur hinausgehen, verstehen kann. Gottes Gegenwart geht also immer zuerst von Ihm selbst aus und der Mensch antwortet. Gleichzeitig bleibt das Wesen Gottes größer als alle menschlichen Vorstellungen.

Die „Wolke des Nichtwissens“
Die anonyme Schrift Die Wolke des Nichtwissens aus dem 14. Jahrhundert zeigt, wie die apophatische Tradition zu einer geistigen Gebetshaltung führt. In Kapitel 6 heißt es: „Und daher will ich alles, was ich denken kann, hinter mir lassen und zum Gegenstand meiner Liebe das erwählen, das nicht gedacht werden kann. Denn Gott kann wohl geliebt, aber nicht gedacht werden.“ Ein Weg, der das eigene Vorstellen zurücknimmt, entsteht aus einer einfachen Einsicht: Der Mensch kann Gott nicht vollständig denken.
Die Schrift beschreibt einen Schritt, der im Gebet vollzogen wird. Der Beter legt das Bedürfnis ab, Gott innerlich festzulegen oder Ihn mit eigenen Bildern zu erfassen.
Dieser Schritt führt nicht zu Distanz. Er öffnet einen anderen Zugang. Der Mensch lässt seine Konstruktionen beiseite, damit der Blick frei wird für das, was Gott selbst schenkt. Die Nähe Gottes bleibt bestehen und wird sogar deutlicher wahrgenommen, weil sie nicht von selbst erzeugten Vorstellungen überlagert wird. Aus dieser Haltung entsteht eine aufmerksame Stille, in der der Mensch empfänglich wird für Gottes Wirken.

Gebet in der gedämpften Zeit
Im November wird beim Gebet für die Verstorbenen besonders spürbar, dass das menschliche Denken an seine Grenzen stößt: Wir erkennen die Endlichkeit unseres Lebens und die Tiefe des Geheimnisses Gottes, das sich nicht in Worte fassen lässt.
Die apophatische Tradition zeigt, dass diese Begrenzung kein Hindernis für die Begegnung mit Gott ist. Wer im Gebet die eigenen Vorstellungen loslässt und aufmerksam bleibt, erfährt, dass Gott selbst auf den Menschen zukommt und das Herz berührt. Auf diese Weise kann die stille Jahreszeit zu einer Zeit des inneren Empfangens werden: Gottes Gegenwart wirkt still, trägt und schenkt Ruhe, Vertrauen und Freude, die niemand nehmen kann. Wir müssen dafür nur unsere Gedanken loslassen.