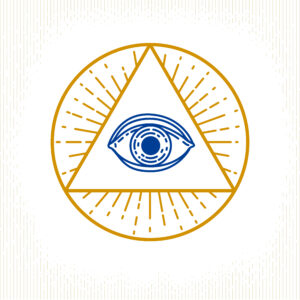Hunger, Erschöpfung oder Schmerz erscheinen vielen als biologische Abläufe, die ein Bedürfnis anzeigen. Nur wenige geben den Regungen des menschlichen Körpers eine tiefere Bedeutung. Die katholische Tradition versteht den Menschen als Einheit aus Körper und Seele. In dieser Einheit drängt der Körper auf Vollendung, ohne dass er sein eigenes Ziel klar erkennt. Diese Spannung öffnet ein theologisch oft vergessenes und zugleich fruchtbares Feld: Der Körper bezeugt seine Geschöpflichkeit, indem er bittet.
Die Sprache der körperlichen Regungen
Hunger verlangt Nahrung, Müdigkeit verlangt Ruhe, Schmerz verlangt Heilung. Jede dieser Erfahrungen ist Ausdruck eines Mangels, der nicht aufgelöst werden kann, solange die körperlichen Regungen anhalten. Sie zeigen die elementare Bedürftigkeit des Menschen und machen sichtbar, wie sehr der Körper auf Erfüllung ausgerichtet ist. In diesen Erfahrungen wirkt ein Aufwärtsdrang: Der Körper möchte genährt, ausgeruht und heil sein. Man könnte sagen, der Körper strebt nach Verwandlung: Hunger soll in Sättigung übergehen, Müdigkeit in Wachheit, Schmerz in Linderung.
So entsteht eine eigene Sprache, die der Körper spricht. Sie artikuliert ein Verlangen, das tiefer reicht als die konkrete Situation. Der Hunger nach Brot verweist auf das unstillbare Bedürfnis nach Leben. Die Müdigkeit verweist auf die Sehnsucht nach Geborgenheit. Die körperliche Begierde verweist auf die Suche nach Anerkennung und personaler Gemeinschaft. Der Körper fordert damit nicht lediglich Befriedigung. Er formuliert ein unausgesprochenes Bittgebet.

Das bittende Fleisch und die Antwort Gottes
Die biblische Rede vom Körper, der bei Paulus als Fleisch bezeichnet wird (Röm 8), beschreibt eine Spannung zwischen dem irdischen Menschen und dem Wirken des Geistes. Im Römerbrief entfaltet Paulus die Erfahrung eines inneren Zwiespalts. Die menschliche Natur wehrt sich gegen das, was sie zugleich ersehnt. Diese Spannung zeigt, dass der Körper zu Gott hin ruft, auch wenn der Mensch seine Regungen missversteht oder fehlleitet.
Die christliche Erlösung greift genau hier ein. Christus nimmt den menschlichen Körper an und trägt alle Gesten des Mangels: Hunger, Durst, Müdigkeit, Verwundbarkeit und Tod. Durch sein Leiden und seine Auferstehung beantwortet er die Bitten des Körpers und zeigt dadurch die endgültige Vollendung des Körpers.
In den Sakramenten wird diese Dynamik erfahrbar. Die Taufe antwortet auf das Verlangen nach Reinigung. Die Eucharistie erfüllt das Bedürfnis nach Nahrung mit der Gabe des Lebens Christi. Die Krankensalbung nimmt die Verwundbarkeit an und führt sie in die Nähe des Heilands. Jedes Sakrament wirkt wie eine Berührung, in der Gott, der Vater, das körperliche Gebet erhört und seine Bedürfnisse erfüllt.
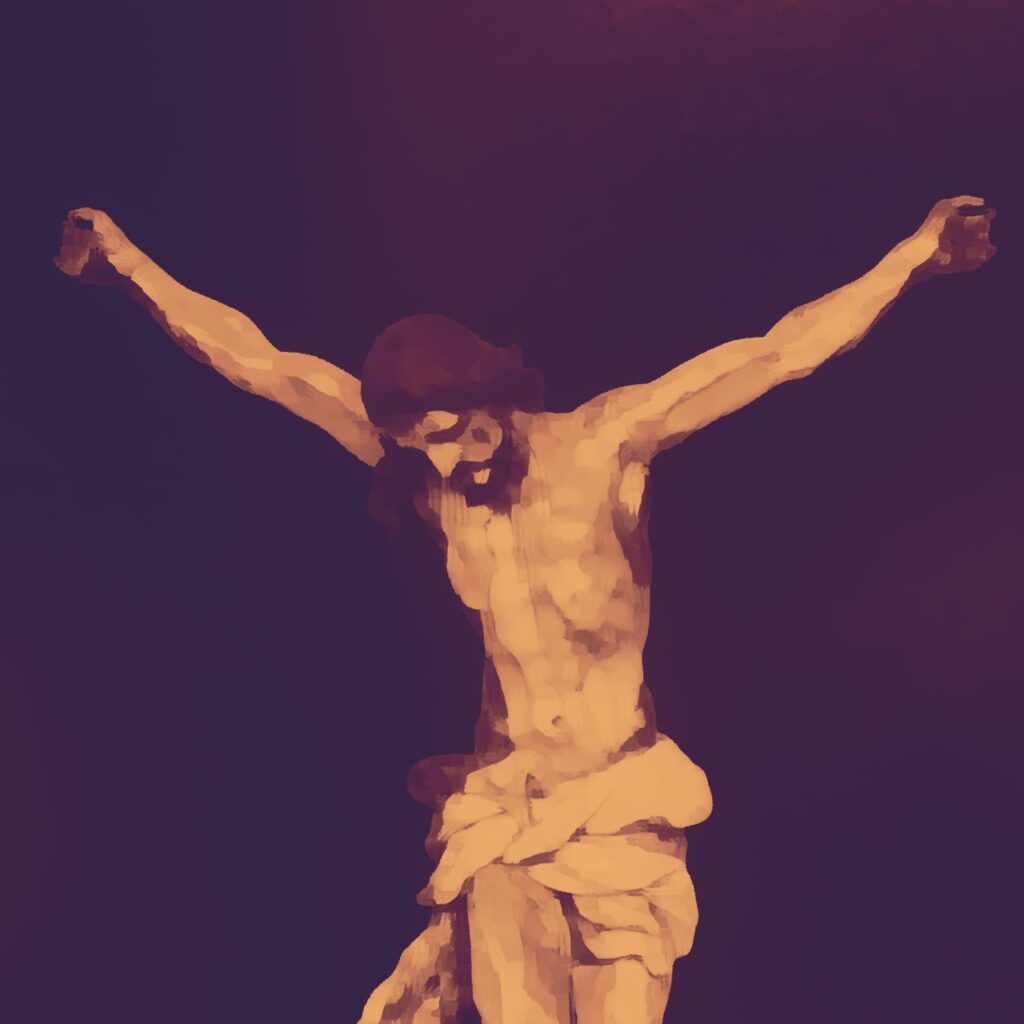
Die Erhörung im verherrlichten Körper
Das Credo bekennt die Auferstehung des Fleisches. Die Vollendung des Menschen umfasst daher auch den Körper. Betend erhält er seine endgültige Antwort. Die Bedürfnisse, die ihn im irdischen Leben antrieben, werden im Licht der kommenden Welt geklärt und verwandelt. Der Mensch erkennt dann, was sein Körper in jeder Regung gesucht hat: die Teilhabe an Gottes Leben, „der göttlichen Natur“ (2 Petr 1,4).
Die körperlichen Bitten bleiben nicht ohne Echo. Sie werden von Gott aufgenommen und in der Auferstehung erfüllt. Oder mit anderen Worten: Der Körper zeigt seine Geschöpflichkeit, indem er bittet. Gott zeigt seine Treue, indem er antwortet. Wir müssen nur genau zuhören.